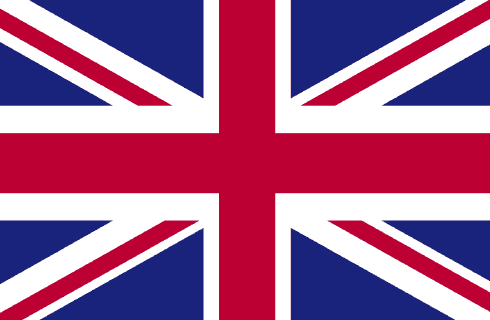Der Bergepanzer Bergepanther (Sd.Kfz.179) und seine Erprobung bei der Kraftfahrversuchsstelle in Kummersdorf 1944
Beim deutschen Bergepanzer vom Typ Bergepanther aus den Jahren 1943 - 1945 handelt es sich um den ersten wirklichen deutschen Bergepanzer, der zur Bergung auch schwerster Kettenfahrzeuge eingesetzt werden konnte. Die Treibscheiben-Seilwinde hatte im direkten Zug die beachtliche Zugleistung von 40 t. Diese Art der "Spillwinde" ist heute wieder am BPz 3 der Bundeswehr zu finden. Die erzeugte Zugkraft ist unabhängig von der Lage des Seiles auf der Seiltrommel. Das Treibscheibensystem ermöglicht daher ein seilschonenderes, zugkraftarmes Aufwickeln des Zugseiles auf der Seiltrommel und befreit das aufgewickelte Seil und die Trommel und deren Lagerung von den bei einfacheren Winden auftretenden hohen Kräften. Um diese Zugleistung ausnützen zu können, war am Heck des Fahrzeuges ein starker Erdsporn zur Abstützung angebracht. Um Baugruppen an anderen Fahrzeugen feldmäßig ein- und ausheben zu können, war ein zerlegbarer Kran vorhanden.
Der Bergepanzer Bergepanther (Sd.Kfz.179) im Anlieferungszustand 1999.
Äußerlich nahezu komplett instand gesetzten Bergepanther der Wehrtechnischen Studiensammlung des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) bei der langen Nacht der Koblenzer Museen im Jahr 2007.
Von den als Bergepanther bezeichneten Fahrzeugen wurden insgesamt ab September 1943 ca. 297 Bergepanther mit der speziellen Pantherwanne gebaut, welche die Aufnahme der Seilwinde und des Sporns ermöglichte. Von diesen 297 Bergepanthern wurden mindestens 88 ohne Winde und Sporn ausgeliefert.
Abgesehen von den 42 Stück als Bergepanther bezeichneten Fahrzeugen bis September 1942, bei denen es sich im wesentlichen nur um turmlose Panther-Fahrgestelle der Ausführung D/A als Schlepper handelte, nahm die Firma Seibert Stahlbau in Aschaffenburg von August 1944 bis März 1945 den Umbau von beschädigten, zur Instandsetzung zurückgelieferten Panthern der Ausführung D/A (nur ohne Bug-MG Kugelblende) zu Bergepanthern ("Umbau-Bergepanther") vor. Auch diese Fahrzeuge hatten weder Winde noch Sporn und ähnelten den ersten Bergepanthern der Firma MAN und Henschel. Auf die Bedienerraumabdeckung mit den Lukendeckeln wurde verzichtet, allerdings rüstete man sie mit allen anderen Bergeeinrichtungen und Werkzeugen aus, welche auch am Bergepanther zu finden waren. Die Firma Seibert hat mindestens 61 Umbau-Bergepanther hergestellt. Insgesamt wurden ca. 113 Fahrzeuge aus der Instandsetzung geliefert. Es ist zu erkennen, dass es sich bei den als Bergepanther bezeichneten Fahrzeugen zu einem großen Teil nur um die turmlosen Schleppfahrzeuge gehandelt hat, die bis zum Ende des Krieges geliefert wurden.
Der Umbau-Bergepanther wie er 1944-45 bei der Firma Seibert in Aschaffenburg gebaut wurde, unterschied sich von den ersten "Bergepanthern" von MAN und Henschel von Juni bis September 1943 unter anderem dadurch, dass die Abdeckung mit Lukendeckeln über Fahrer und Funker weggelassen wurde, Stoßplatten am Bug (später wieder weggelassen) und Halterungen für das Schleppgeschirr am Heck angebracht wurden.
Weiterhin ist auch ein nennenswerter Teil der Bergepanther mit der speziell gefertigten Wanne für Winde, Spornanbringung und Pritschenaufbau (siehe Zeichnungen unten) wegen fehlender Winden nur als Schleppfahrzeug eingesetzt worden, siehe WTS-Fahrzeug geliefert von Daimler-Benz im Frühjahr 1944, siehe Anlage.
Diese bisher nicht bekannten Fakten mögen dazu beigetragen haben, dass in den verschiedensten Publikationen auch auf Fotos aus der Endphase des Krieges fälschlicherweise "frühe" Bergepanther identifiziert wurden.
Die Erprobung des Bergepanthers 1944
Das Heereswaffenamt erteilte seiner Kraftfahrversuchsstelle in Kummersdorf im März 1944 den Auftrag, folgende Versuche mit dem Bergepanther durchzuführen:
- Durchführung von Berge-Versuchen mit Panther- und Tiger-Fahrgestellen.
- Erprobung der Seilwinde auf Truppenbrauchbarkeit.
- Brauchbarkeit des zum Abstützen vorgesehenen Sporns, Verhalten desselben beim Fahren im Gelände und beim Abschleppen von gleichartigen Fahrzeugen.
- Berge-Versuche in verschiedenartigem Gelände und bei verschiedenen Entfernungen.
Dem Entwurf des 1. Zwischenberichtes vom 28. April 1944 ist zu entnehmen, dass das Erprobungsfahrzeug bereits am 2. und 3. März sowie vom 14. – 17.3.44 in Berka zur Verfügung gestanden hat.
Die größte gemessene (direkte) Zugkraft der 40 t-Winde betrug 35 t, gab aber sonst zu keinen Beanstandungen Anlass. Die schadhafte Seilreinigungsbürste führte einmal zum fehlerhaften Aufwickeln des Seiles auf der Trommel. Es wurde bemerkt, dass eine nicht genügende Reinigung des Seiles zum schnellen Verschmutzen der Windenrinne führe.
Bei einer Gesamtzugkraft von 70 t bog sich der nur aus 4 mm anstatt 6 mm dicken Blechen bestehende Sporn auf. Mit verstärktem Sporn brach bei der gleichen Belastung der linke 60 mm starke Lagerbolzen und die Lagerplatten verbogen sich. Als Ursache erwies sich eindeutig, dass der Sporn das Bestreben hatte, zu tief in den weichen Boden einzudringen, und dadurch die Lagerung überlastet wurde. Der Versuch, den Sporn durch am Heck angebrachte Ketten am tiefen Eindringen zu hindern, scheiterte wegen des Bruchs der Ketten. Zur Umgestaltung des Spornes oder evtl. Verstärkung der Ketten beim Hersteller wurde das Fahrzeug dorthin transportiert.
Für die Abschleppkupplung entwickelte MAN ein Zwischenstück (eine aufsteckbare Verlängerung), da ansonsten beim Abschleppen mit Schleppstangen diese bei leichten Kurvenfahrten an den Armen des Spornes innen abgeknickt wurden. Das Fahren von Kurven beim Abschleppen, auch im Gelände, ergab damit ein zufriedenstellendes Ergebnis. Notwendig war eine weitere Verstärkung des Zwischenstückes und weitere Verlängerung, damit der Neigungswinkel zwischen schleppendem und geschlepptem Fahrzeug mindestens 30° betragen konnte.
Weitere Punkte behandeln die auftretenden Zugkräfte beim Bergen, die Art des Anhängens des zu bergenden Panzerkampfwagens und das Bergezubehör.
Der Behelfskran wurde wegen seines nur eingeschränkten Schwenkbereiches bemängelt. Zusammenfassend heißt es, dass sich bei den ersten Versuchen von wenigen Tagen gezeigt habe, dass das Fahrzeug zum Bergen von schweren Panzerkampfwagen auch in schwierigen Fällen wegen:
- der großen Zugkraft
- der schnellen Einsatzbereitschaft
- des Panzer- und Waffenschutzes
hervorragend geeignet sei. Einige Verbesserungen seien notwendig. Der ebenfalls überlieferte Entwurf des 2. Zwischenberichtes vom 3. Juli 1944 beschäftigt sich intensiver mit Details und steht unter dem Eindruck verschiedener Motorstörungen und –schäden. Das Fahrzeug wurde nach Instandsetzung und Änderung am 28. April 1944 in Kummersdorf angeliefert und verfügte außerdem über verstärkte Planeten-Seitenvorgelege ("Umlaufgetriebe"), die mit erprobt werden sollten.Der neue verstärkte Sporn, zur Vermeidung des tiefen Einsinkens mit zwei versteiften Blechen an der Oberkante versehen, bewährte sich besonders in festen Boden und an Sumpfrändern. Er ermöglichte eine gemessene Gesamtzugkraft von mindestens 112 t.Als lose Seilrollen wurden die wesentlich leichteren Rollen der Fa. Eberhard aus Ulm aus dem "Bergesatz Bergegerät für Panzerkampfwagen (Pz.Kpfw.) unter 30 t" erprobt. Sie zeigten auch bei einer Belastung mit 56 t keine wesentlichen Schäden und wogen nur 54 kg gegen 163 kg der MAN-Rolle. Es wurde erwartet, dass auch die erwarteten Rollen für 60/120 t der Fa. Eberhard der Forderung nach Handlichkeit mehr entsprächen als die MAN-Rolle.
Festgestellte Mängel waren u.a.:
- Bedienhebel der Winde zu tief angebracht, Bediener kann weder die Winde noch die Bergestrecke übersehen. Verlängerung des Bremshebels sofort erforderlich.
- Anordnung von Abschleppstangen und Windenseil machten es unmöglich, die Motorklappe zu öffnen. Bei Motorbränden ist keine schnelle Hilfe möglich.
- Ölstandschauglas der Winde schlecht zu beobachten.
- Sicheres Seilausziehen nur im Mannschaftszug möglich. Da bei normalerweise beladener Ladebrücke die Winde nicht beobachtet werden kann, besteht ohne zusätzliche Verbesserungen an der Winde eine große Gefahr des Verwickeln und Verklemmen des Seiles.
- Schwieriges Einführen des Haltebolzens der aus Spannschlössern mit Ösen bestehenden Spannschlössern. Große Gefahr der Beschädigung bzw. Zerstörung der Schlösser.
- Faltverdeck über Bedienerraum schließt nicht, ist zu klein und nicht wetterfest.
- Vorschlag auf Anfügen von Haltewinkeln unter den Stoßplatten am Bug, damit dort beim Drücken der Bergebalken aufgelegt werden kann.
- Seilreinigungsbürsten drehen sich nicht, dadurch schwache Reinigungswirkung.
- Seilkopf zu breit, passt nicht in die Abschleppkupplung.
- Andrehkurbel wegen des Heckspornes zu kurz.
Wegen der verschiedenen Motorschäden konnten Schleppversuche nur über 24 km Straße und 95 km Gelände durchgeführt werden. Dabei befriedigend Ergebnisse beim Schleppen von Pz.Kpfwg. Panther, Tiger E, Tiger B und KW I. Ergebnisse:
- Zugkräfte im 1. Gang: Bei losem Sand: 20 t ohne, 27 t mit behelfsmäßigen Bergegreifern (Schneegreifer)
- Etwa 12 t Zugkraftüberschuss beim Schleppen zur Überwindung von Beschleunigungs- und Steigungswiderständen.
- Dauerschleppversuch mit angehängtem PzKpfwg. Panther über 4 km Straße und 51 km Gelände in 5 ½ Std. Durchschnittsgeschwindigkeit: 10 km/h.
- Gefahrene Gänge: Straße: 4. und 5. Gang, Gelände: meist 3. Gang, in Bodenwellen 2., auf glatten Strecken 4. Gang.
Das Fahrzeug hatte bei der Firma MAN eine Laufleistung von 555 km erbracht, bei der Erprobung 517 km. Bei der Versuchsstelle mussten nach 104 km und nach 143 km größere Reparaturen am Motor durchgeführt werden. Nach 197 km musste er wegen mangelnder Leistung ausgewechselt werden. Der neue Motor hatte nach 231 km einen Vergaserbrand. Dazu waren laufende außerplanmäßige Wartungsarbeiten wegen Leistungsmängeln an der Zünd- und Vergaseranlage notwendig. Die Versuchsstelle vertrat daher in diesem Zusammenhang die Ansicht, dass der sowieso als störanfällig bekannte Motortyp Maybach HL 230 wie bei der Versuchsstelle, auch bei der Truppe nicht "auf einigermaßen gute Kilometerleistungen im Schleppbetrieb" kommen wird und betonte die Forderung nach einem Motor mit "Büffelcharakteristik". Weitere Ergebnisse:
- Keine Beanstandungen an den Planeten-Seitenvorgelegen.
- Das Zwischenstück für die Abschleppkupplung müsse wie schon im 1. Zwischenbericht angemerkt, um ca. 100 mm verlängert werden, damit die Abschleppstangen nicht in tiefen Bodenwellen am Spornschild anschlagen.
- Am Laufwerk gab es nur kleinere Verschleiß-Schäden, jedoch keine Beanstandungen. Unangenehm mache sich bemerkbar, dass beim Schleppen in den Kurven der feste Lenkradius nicht ausreiche. Es müsse oft mit der Lenkbremse gefahren werden, so dass das Gespann ruckweise mit teilweise durchrutschenden Ketten in die Kurve gezogen wird.
Abschließend wird berichtet, dass bei Zugversuchen im vierfachen Zug eine Gesamtkraft von 120t gemessen worden ist und Beschädigungen nicht eingetreten seien. Verbesserungen an Einrichtung und Zubehör wären noch notwendig. Als Abschleppfahrzeug sei der Bergepanther aufgrund des störanfälligen Motors und des wenig anpassungsfähigen (Panzerkampfwagen Panther-serienmäßigen) Einradienlenkgetriebes nur bedingt geeignet. Der Entwurf des letzten 3. Zwischenberichtes vom 7. März 1945 behandelt als einzigen Punkt die halbautomatische Feststellung des Spornes in Fahrstellung und geht damit auf einen Punkt ein, der bereits im 2. Zwischenbericht angesprochen wurde. Es wird ein einfacher Verbesserungsvorschlag beschrieben, bei dem anstatt der schwierigen Einführung eines Steckbolzens per Hand, sich beim Anheben des Heckspornes zwei Haken in angeschweißte Zugösen am Heck automatisch einklinken. Die Konstruktion sei im Betrieb erprobt und arbeite zuverlässig.Da ein überprüfter Serien-Bergepanther neuester Ausführung trotz gegenteiliger Angaben wieder mit dem ursprünglichen Spannschlössern ausgestattet sei, werde vorgeschlagen, die neue Vorrichtung serienmäßig einzubauen und für die vorhandenen Bergepanther in der Truppenzeitschrift "Von der Front – für die Front" bekannt zu geben. Interessant erscheint zu der Erprobungsbewertung als ein “nur bedingt geeignetes“ Abschleppfahrzeug, dass bereits im Juni 1944 im Nachrichtenblatt der Panzertruppen ein Artikel über einen Unteroffizier erschien, der seinen Bergepanther (laut Fahrgestellnummer vom Juli 1943, turmloses Panther-Fahrgestell) über 4800 km ohne Motorwechsel und ohne Schäden an Seitenvorgelege, Getriebe und Kupplung gefahren habe, davon über 1000 km mit einem Panzerkampfwagen Panther im Schlepp.
Technische Daten:
Bezeichnung:
Bergepanther (Sd. Kfz. 179)
Entwicklung:
MAN, Rückgriff auf die eingestellte Entwicklung eines amphibischen Pioniersonderfahrzeuges aus den Jahren 1939-1941
Hersteller und Produktionszahlen:
- MAN, Nürnberg, 06.43, 12 Stück (ohne Winde und Sporn auf dem Fahrgestell mit durch einen Blechdeckel abgedeckter Turmöffnung aus der laufenden Fertigung der Panther Ausf. D)
- Henschel, Kassel, 07.43-11.43, 70 Stück (die ersten 30 Stück wie vor bei MAN, die letzten 40 Stück mit der speziellen Bergepanther-Wanne Ausf. A, ohne Winde und Sporn)
- Daimler-Benz, Berlin-Marienfelde, 02.44 - 03.44, 40 Stück (wie die letzten 40 Stück bei Henschel, ebenfalls jedoch ohne Winde und Sporn)
- Demag, Berlin-Falkensee, 03.44-10.44, 123 Stück
- Demag, Berlin-Falkensee, 10.44-02.45, 94 Stück (modifizierte Bergepanther-Wanne auf der Basis Wannenform Panther Ausf. G)
- Von den Bergepanthern mit spezieller Wanne mindestens 88 Stück ohne Winde und Abstützsporn ausgeliefert.
Hersteller des speziellen Bergepanther-Panzergehäuses:
- Ruhrstahl, Hattingen
- Dortmund-Hörder Hüttenverein, (D.H.H.V.), 10 Stück im August 1943 (bisher nicht verifiziert)
Panzerbergeausrüstung:
- 40 t- Seilwinde mit Abstüzsporn
- Hebebaum
- Verstärkte Abschleppkupplung
- Schweres Abschleppgeschirr
- Starke senkrechte Stoßplatten am Fahrzeugbug
- Bergebalken
- Anschlagmittel
- Ladebrücke zur Beförderung von Baugruppen und Ausrüstung
- Zusatztanks
Seilwinde:
- Hersteller: Firma Raupach, Warnsdorf
- Zugkraft: 400 kN (im direkten Zug)
- Spillwinde mit konstanter Zugkraft
- Seillänge: 150 m
- Seilgeschwindigkeit: max. 10m/min
Motor:
Vergasermotor Maybach HL 230 P30, 12 Zylinder, 23,8 l Hubraum, 514 KW (700 PS) bei 3000 1/min (konstruktiv), im Einsatz 600 PS bei 2500 1/min (gedrosselt)
Schaltgetriebe:
ZF AK 7-200, 7 Vorwärts-, 1 Rückwärtsgang, handgeschaltet, II.-VII. Gang synchronisiert.
Kupplung:
Dreischeibentrockenkupplung Fichtel & Sachs LAG 3/70 H (an Getriebe angeflanscht)
Lenkgetriebe:
MAN-Einradien-Lenkgetriebe, Betätigung mechanisch mit Öldruckhilfe durch Lenkhebel
Bremsen:
Mechanisch mit Öldruckhilfe betätigte Vollscheibenbremsen, Südd. Arguswerke, Typ LB 900.2, System Dr.-Ing. Klaue
Gesamtmaße, Gefechtsgewicht und Leistungen:
- 8860 mm *3420 mm *2700 mm (mit Abstützsporn)
- 43000 kg
- Wendekreisdurchmesser: min. 10 m
- Bodenfreiheit: 0,56 m
- Steigfähigkeit: 30°
- Kletterfähigkeit: 0,9 m
- Grabenüberschreitfähigkeit: 2,45 m
- Watfähigkeit: 1,90 m
- Zugkraft beim Schleppen: 200 kN ohne, 270 kN mit Schneegreifern (in losem Sand)
- Zugraft beim Bergen mit Winde gegen Sporn: 1200 kN (mit 2 losen Rollen)
- Höchstgeschwindigkeit: 46 km/h bei Drosseldrehzahl
- Reichweite: Straße 320 / Gelände 160 km
- Kraftstoffvorrat: 1075 Liter
- Besatzung: 1 Unteroffizier, 3 Mannschaften
Bewaffnung:
- 2 cm KwK 38 (nicht alle Bergepanther mit Lafette ausgerüstet, nicht bei turmlosen Fahrgestellen und Umbau-Bergepanthern)
- 2 MG
- 1 MP
Panzerung:
- Wanne Front oben 80 mm
- Wanne Front unten 60 mm
- Wanne Seiten und Heck 40 mm
Quellenangaben:
Thomas L. Jentz, Hilary Doyle, Panzer Tracts No. 16-1, Bergepanther Ausf. D, A, G, Boyds MD 20841, 2013, www.panzertracts.com
Thomas L. Jentz, Hilary Doyle, Panzer Tracts No. 16, Bergepanzerwagen, ISBN 0-9648793-7-9, Boyds MD 20841, 2004
Thomas L. Jentz, Hilary Doyle, Panzer Tracts No. 23, Panzer Production from 1933 to 1945, Boyds MD 20841, 2011
Walter J. Spielberger, Der Panzerkampfwagen Panther und seine Abarten, Stuttgart 1978
Fritz Hahn, Waffen und Geheimwaffen des deutschen Heeres 1933-1945, Bonn, 1998
Chamberlain, Doyle, Encyclopedia of German Tanks of World War Two, London, 1978, 1999
Bundesarchiv / Militärarchiv RH8/1647
Anlage:
Merkmale dafür, dass der Bergepanther Fahrg.Nr. 175539 der Wehrtechnischen Studiensammlung ab Werk nicht mit einer Winde und einem Hecksporn ausgerüstet gewesen ist.
Halterung, vermutlich für Katzenauge, an gleicher Stelle wie beim Panzerkampfwagen. Keine Druckstellen an den sechs umgebenden Schrauben oder Anzeichen dafür, dass dort einmal ein Faltgelenk angeschraubt gewesen ist. Zum Vergleich siehe Druckstellen an den Plätzen der rechteckigen Abdeckungen für Befestigungsbohrungen der Anhängekupplung (rechts) und des Abschlussdeckels (darüber). Quelle: Gerätehauptdepot Damstadt via WTS (Bildausschnitt)
Keine Anhaltspunkte für die Anbringung von Bedienhebeln (rechts und unter den Bedienersitzen) für die Winde. Quelle: Frank Köhler
Keine Gewinde in den drei Sacklöchern im hinteren Querträger für die Winde. Quelle: Frank Köhler
Ein Trägerblech für ein Turmschwenkwerk, welches bei Nichteinbau der Winde als Antrieb für die Öldruckpumpen eingebaut werden musste, ist vorhanden. Quelle: Frank Köhler
Autor: Frank Köhler © 2000-2018